Mnemosyne als Er-Innerung von Wahmehmung
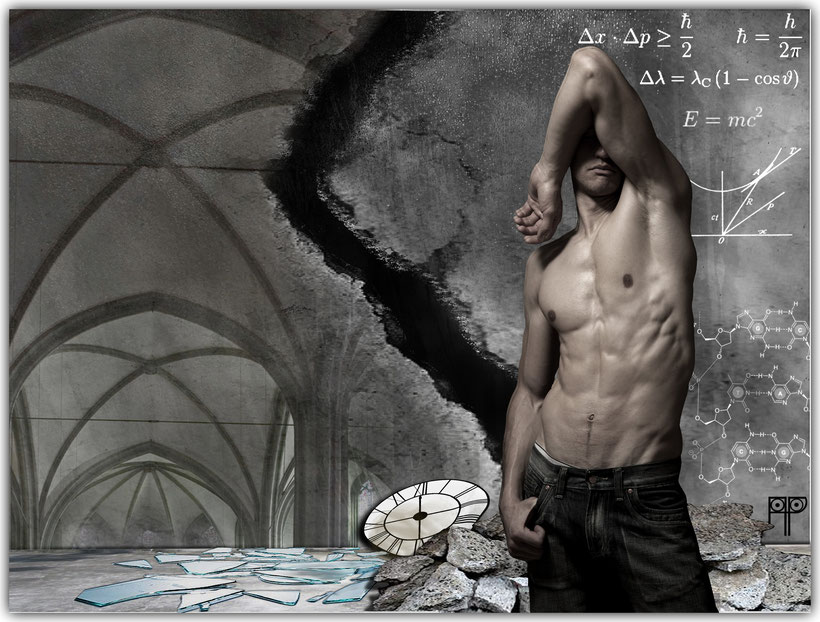
Bei allen bisher betrachteten Wortern für das Gedächtnis, die Mnemosyne als Er-Innerung von Wahmehmung und Erfahrung mitzudenken. Schleiermachers wunderbare Übersetzung einer Passage im Kratylos erfasst diesen Gedanken, den Platon in einer spielerisch-ernsten
Definition des Menschen (anthrôpos) versteckt: Er ist das Wesen, welches, was es gesehen hat, zusammenschaut (anathrei ho opopen).
Denken wird entsprechend auch als Sammlung (der Seele oder von etwas in der Seele) gedeutet. Man erhält eine allgemeine Merkformel für das Denken, wenn man an Platons weiten Gebrauch der griechischen Wörter „logos“ für „Wort“, „Begriff“, am Ende sogar für irgend eine symbolisch
vemittelte Repräsentation oder Artikulation, „legeín“ für „legen“ und „lesen“ und „eidos“ für „Arttyp“, „Form“, am Ende sogar „Struktur“ erinnert: Denken ist ein legein des logos des eidos, Auslegung der Artikulation einer Struktur. Denken ist also Aktualisierung der Kompetenz, implizite Formen in Natur und Handlungswelt durch Zusammenlegen von Elementen explizit zu machen und diese Strukturmodelle zu lesen oder auszulegen. Ein Denken in diesem Sinn muss das Wahrnehmen und Vorstellen begleiten, wenn das Wahrgenommene oder Vorgestellte begriffen, strukturiert und damit durch Zeichen artikulierbar sein soll.
Die hier vorgelegte Überlegung möchte dazu zeigen, dass es sich lohnt, sich um die gerade deswegen so fremdartigen, weil sich an der Normalsprache orientierenden, Analysen Heideggers, Hölderlins oder schon Hetaklits und Derridas zum Denken zu kümmern. Diese teilen immerhin nicht den Aberglauben des Zeitgeists, der nur mathematische Formeln und Rechnungen klar findet und zu verstehen gedenkt.
Pirmin Stekeler-Weithofer
Der Mensch ist reflexive Kontingenz
Markus Gabriel
Der Mensch ist notwendig semantisch kreativ. Er muss einen Gegenstandsbereich auswählen, über den er quantifiziert1, um auf diese Weise Entitäten2
gelten zu lassen, denen Prädikate zu- und abgesprochen werden können. Der Mensch ist somit Schöpfer von Substanzen. Substanzen sind Objektivationeni semantischer Freiheit, notwendige Anhaltspunkte unserer prädikativen Anstrengungen, Voraussetzungen der propositionalen Wahrheit und als solche Vergegenständlichungen. Die
Gegenstände des Gesprächs werden vom Gespräch als mögliche Anhaltspunkte ausgewählt und in diesem Sinne geschaffen. Sie gehen als Gegenstände eines Gesprächs, das sie immer nur unter einer
bestimmten Beschreibung präsentiert, die nicht alternativlos ist, dem Gespräch nicht vorher.
Die Vergegenständlichung unserer semantischen Freiheit ist allerdings kein missliches Geschick, wenn es auch in der Philosophie des zwanzigsten Jahrhunderts als vernichtender Einwand gegen jedes
Denken galt, wenn es irgendetwas vergegenständlichte. Denn nur in den Gegenständen gerinnt unsere ansonsten leere Freiheit zu Formen, in denen sie sich allererst selbst erkennen kann. Die
Vergegenständlichung unserer Freiheit (etwa im Recht) ermöglicht allererst, diese als Freiheit zu erfahren, als Freiheit, dies so oder auch anders sehen zu
können. Glücklicherweise gibt es also Standpunkte und substantielle Einsichten, wenn diese auch immer nur dazu dienen, ihrerseits zum Gegenstand des Gesprächs zu werden und damit in andere
Standpunkte und substantielle Einsichten überzuleiten. Die Geschichte wäre ansonsten völlig leer, sie wäre mit Heidegger gegen diesen gewendet nur eine Geschichte des Seins und nicht auch des
Seienden.
Der Mensch ist also der Schöpfer einer Geschichte des Seienden, weil er ein logisches Wesen ist. Als Wesen, das sich auf die Welt nur in der Sprache beziehen kann, vergegenständlicht der Mensch
zwar seine semantische Wahlfreiheit zwischen Bezugssystemen. Doch ohne diese Objektivationen könnte er sich gar nicht auf sich selbst als dasjenige Wesen beziehen, dem die Wahlfreiheit zwischen
Bezugssystemen zukommt.
Ein Bewusstsein des Anders-sein-Könnens, das sich einstellt, weil der Mensch etwas als etwas bezeichnet und dadurch von
anderem unterscheiden kann. Sobald sich etwas von etwas Anderem prädikativ nachvollziehbar unterscheiden lässt, wird ein Horizont möglicher Prädikationen eröffnet, den man in Erinnerung an
Heidegger: Das Seyn nennen kann. Das Seyn ermöglicht, dass irgendetwas so-und-so sein kann. Alles, was auf irgendeine epistemisch und d.h. prädikativ nachvollziehbare Weise ist, ist nur vor einem
Hintergrund erkennbar, der selbst nicht erkennbar ist. Wenn irgendetwas so-und-so sein kann, dann könnte es auch sein, dass es anders hätte kommen können, dass es eigentlich anders ist oder dass
es einmal anders sein wird. Dadurch, dass wir über einen Gegenstandsbereich quantifizieren und Unterscheidungen treffen, tritt das Seyn in den Hintergrund – ja, genau genommen nicht einmal in den
Hintergrund, da der Hintergrund auch nur als solcher unterscheidbar ist, wenn wir bereits einen Vordergrund ausgewählt haben. Die Entscheidung, dies
als das gelten zu lassen, eröffnet also einen Spielraum der Kontingenz und damit eine Zone des Nichtwissens. Diese lässt sich prinzipiell nicht im Hinblick auf
restlose Transparenz hin ausschöpfen. Aus der Zone des Nichtwissens kommt uns deshalb vieles entgegen, das wir konstitutiv nicht antizipieren können. Deswegen ist der Mensch als zon logon
echon, d.h. als sprechendes Wesen, dasjenige Wesen, das weiß, dass es möglicherweise vieles oder gar alles von dem, was es zu wissen glaubt, nicht weiß. Der Mensch
ist somit Kontingenz-Bewusstsein.
Die Sprache eröffnet also einen Spielraum der Kontingenz. Auf diesen Spielraum bezieht sich das niemals zu Ende kommende Gespräch der Menschheit. Diese Situation kann der Mensch als solche
erfahren, indem er sie selbst in den Horizont der Sprache einholt. Auf diese Weise wird er sich seines Kontingenz-Bewusstseins bewusst, so dass er reflexive Kontingenz wird. In dieser Situation befindet sich der Mensch in seiner philosophischen Reflexion auf sich, d.h. die Anthropologie heute. Die reflexive Kontingenz ist dabei
selbstreferentiell geschlossen: Sie konstruiert sich im Medium ihrer selbst als reflexive Kontingenz. Die Sprache vermag über sich selbst zu sprechen.
Dass der Mensch reflexive Kontingenz ist, hat das immer wieder aufgewiesene anthropologische Faktum zur Folge, dass er ein geschichtliches Wesen ist, das keine Natur im Sinne einer immer schon
vorgegebenen und das bedeutet v.a. inhaltlich bestimmten Norm zu erfüllen hat, die ihn von außen überkommt. Denn reflexive Kontingenz zu sein, ist nicht schon eine Natur in einem Orientierung
garantierenden Sinne. Deshalb muss der Mensch sich ständig selbst erfinden, was in der Tradition der abendländischen Metaphysik in der Form eines Schöpfungsgeschehens auf Gott selbst übertragen
wurde. Auf diese Weise pflegte der Mensch sich bis zur Moderne von sich selbst zu entlasten, wenn ihm auch in allen mythologischen und christologischen Spekulationen an irgendeinem Punkt immer wieder aufgegangen ist, dass er selbst gefährlich nahe an die göttliche Macht herankommt, bestimmte Verhältnisse allererst e nihilo
hervorbringen zu müssen. Die verdrängte Kontingenz der Sprache war immer schon präsent, ist allerdings erst in der Moderne explizit geworden. Die reflexive Kontingenz als geschichtlicher Standort
des heutigen menschlichen Daseins, das radikale Anders-sein-Können von allem, ist wohlgemerkt auch nur ein geschichtlicher Standort. Es stellt sich uns so dar, als ob der Mensch keine Natur
hätte. Dieses Menschenbild lässt sich auch nicht ohne weiteres aus der Welt schaffen, da jeder Versuch einer positiven Bestimmung des Menschen, jeder Versuch, ihm eine Natur anzudichten,
philosophisch unglaubwürdig erscheint. Es könnte auch anders sein …
1 Quantifizierung bedeutet Angabe als Zahlenwert und kommt von lateinisch quantum („wie viel“, „wie groß“). Dabei werden die Eigenschaften und Beschaffenheit eines Gegenstands oder Sachverhalts in messbare Größen und Zahlenwerte umformuliert.
Voraussetzung dafür ist die Definition einer quantifizierbaren Größe und die Angabe eines Quantifizierungsverfahrens. Eine Vergleichbarkeit entsteht durch die Anwendung desselben Verfahrens auf unterschiedliche Dinge oder Sachverhalte. Quantifizierung ermöglicht die Entwicklung und Verwendung differenzierter quantitativer Modelle eines Gebietes und damit bewusst gesteuertes, differenziert-zielgerichtetes Handeln – im Gegensatz zu intuitiv gesteuertem Handeln.
2 Entität (mittellateinisch entitas, zu spätlateinisch ens ‚seiend, Ding‘) ist in der Philosophie ein Grundbegriff der Ontologie, der in zwei Bedeutungen verwendet wird:
-
Zum einen bezeichnet er etwas, das existiert, ein Seiendes, einen konkreten oder abstrakten Gegenstand. In diesem Sinn wird der Begriff der Entität in der Regel als Sammelbegriff verwendet, um so unterschiedliche Gegenstände wie Dinge, Eigenschaften, Relationen, Sachverhalte oder Ereignisse auf einmal anzusprechen. Dies ist die im zeitgenössischen Sprachgebrauch gängige Verwendung.
-
Zum anderen kann er auch für das Wesen eines Gegenstandes im Sinne eines für das Dasein und die Identität des Gegenstands notwendigen Elements stehen. In dieser Hinsicht ist Entität dem klassischen Substanz-Begriff sinnverwandt.
Der erste Sinn des Begriffes ist der heute gebräuchlichere. Allerdings wird oft die Selbstständigkeit der Existenz der Entität nur noch für ein konkretes Diskursuniversum behauptet.
i Objektivation
Die Objektivation meint die Vergegenständlichung, vom rein Subjektiven abgelöste Darstellung und Verwirklichung. Der Begriff hat seinen Ursprung in der Erkenntnistheorie und Philosophie.
Philosophie
Der Begriff der Objektivation oder Vergegenständlichung stammt aus der Hegel-Marxschen Tradition und wird im Zusammenhang mit Entäußerung und Entfremdung diskutiert.
Bei Hegel ist die Objektivation die Bezeichnung für den Prozess, in dem sich das Subjekt durch Handeln "zum Dinge (macht, zur) Form, die Sein ist." Jede Handlung dieses Subjekts, sei es, dass es eine Bitte äußert oder etwas herstellt, macht etwas von diesem Subjekt zum Objekt, zum Teil seiner Umwelt, das als an sich seiender Gegenstand auf das Subjekt zurückwirken kann.
Bei Arthur Schopenhauer sind Objektivationen die Erscheinungen, in der sich der einheitliche Wille als Grundlage der Welt manifestiert. Er objektiviert sich in der Erscheinungswelt als Wille zum Leben. „Wie der Intellekt physiologisch sich ergiebt als die Funktion eines Organs des Leibes; so ist er metaphysisch anzusehn als ein Werk des Willens, dessen Objektivation, oder Sichtbarkeit, der ganze Leib ist. Also der Wille zu erkennen, objektiv angeschaut, ist das Gehirn; wie der Wille zu gehn, objektiv angeschaut, der Fuß ist; der Wille zu greifen, die Hand; der Wille zu verdauen, der Magen; zu zeugen, die Genitalien u.s.f. Diese ganze Objektivation ist freilich zuletzt nur für das Gehirn da, als seine Anschauung: in dieser stellt sich der Wille als organischer Leib dar. Aber sofern das Gehirn erkennt, wird es selbst nicht erkannt; sondern ist das Erkennende, das Subjekt aller Erkenntniß. Sofern es aber in der objektiven Anschauung, d.h. im Bewußtsein anderer Dinge, also sekundär, erkannt wird, gehört es, als Organ des Leibes, zur Objektivation des Willens.“
Wilhelm Dilthey beschreibt Objektivationen als das äußere Reich des Geistes. „Diese Manifestationen des Lebens, wie sie in der Außenwelt dem Verständnis sich darstellen, sind gleichsam eingebettet in den Zusammenhang der Natur. Immer umgibt uns diese große äußere Wirklichkeit des Geistes. Sie ist eine Realisierung des Geistes in der Sinnenwelt vom flüchtigen Ausdruck bis zur jahrhundertelangen Herrschaft einer Verfassung oder eines Rechtsbuchs. Jede einzelne Lebensäußerung repräsentiert im Reich dieses objektiven Geistes ein Gemeinsames. Jedes Wort, jeder Satz, jede Gebärde oder Höflichkeitsformel, jedes Kunstwerk und jede historische Tat sind nur verständlich, weil eine Gemeinsamkeit den sich in ihnen Äußernden mit dem Verstehenden verbindet; der einzelne erlebt, denkt und handelt stets in einer Sphäre von Gemeinsamkeit, und nur in einer solchen versteht er.“
Ähnlich kennzeichnet Nicolai Hartmann Objektivationen als vom Geiste geschaffene Gebilde, in denen er sich ausprägt und veranschaulicht. Er stellt sie in den Gegensatz zur „Objektion“. „Was objektiviert wird, das setzt keinerlei Sein unabhängig vom Geiste voraus. Es ist vielmehr dem lebenden Geist als das Seinige entnommen und wird erst durch die Objektivation ausgeformt und in die Unabhängigkeit von ihm herausgestellt. Objektivation ist also in gewissem Sinne das Gegenteil von Objektion. Objektivation ist Spontaneität, das Schaffen, ein In-die-Welt-Setzen. Objektion ist Erfassen, Rezeptivität, Aufnehmen, Begreifen. Sie erschöpft sich im Wahrnehmen, Erfahren. Schauen, Eindringen, Ermitteln. Ihr Gegenstand ist ihr gegeben. Sie rührt weder an sein Dasein noch an seine Geformtheit.“ „Jede Äußerung, jedes Wort, jede Geste, jedes Verhalten des Individuums ist schon Objektivation.“
